Junge Alte im Aufbruch
Während die einen sich aktiv um die Gestaltung und Planung des Alters kümmern, erleben andere ihr Altern weiterhin als unausweichliches Schicksal. Entsprechend ihren Lebenserfahrungen und, je nach beruflichen, familiären und sozialen Erfolgen beziehungsweise Misserfolgen, gehen die Menschen mit ihrem Altern unterschiedlich um. Oder anders gesagt: Menschen werden mit steigendem Lebensalter nicht gleicher, sondern ungleicher. François Höpflinger, Begründer des «Age Reports» und Referent am Infoanlass «Mein Zuhause im Alter», sagt dazu: «Für die meisten «Babyboomer» ist das dritte Lebensalter dynamisch und aktiv. Die «jungen Alten» von heute sind körperlich, sozial und kulturell aktiver als frühere Generationen.»
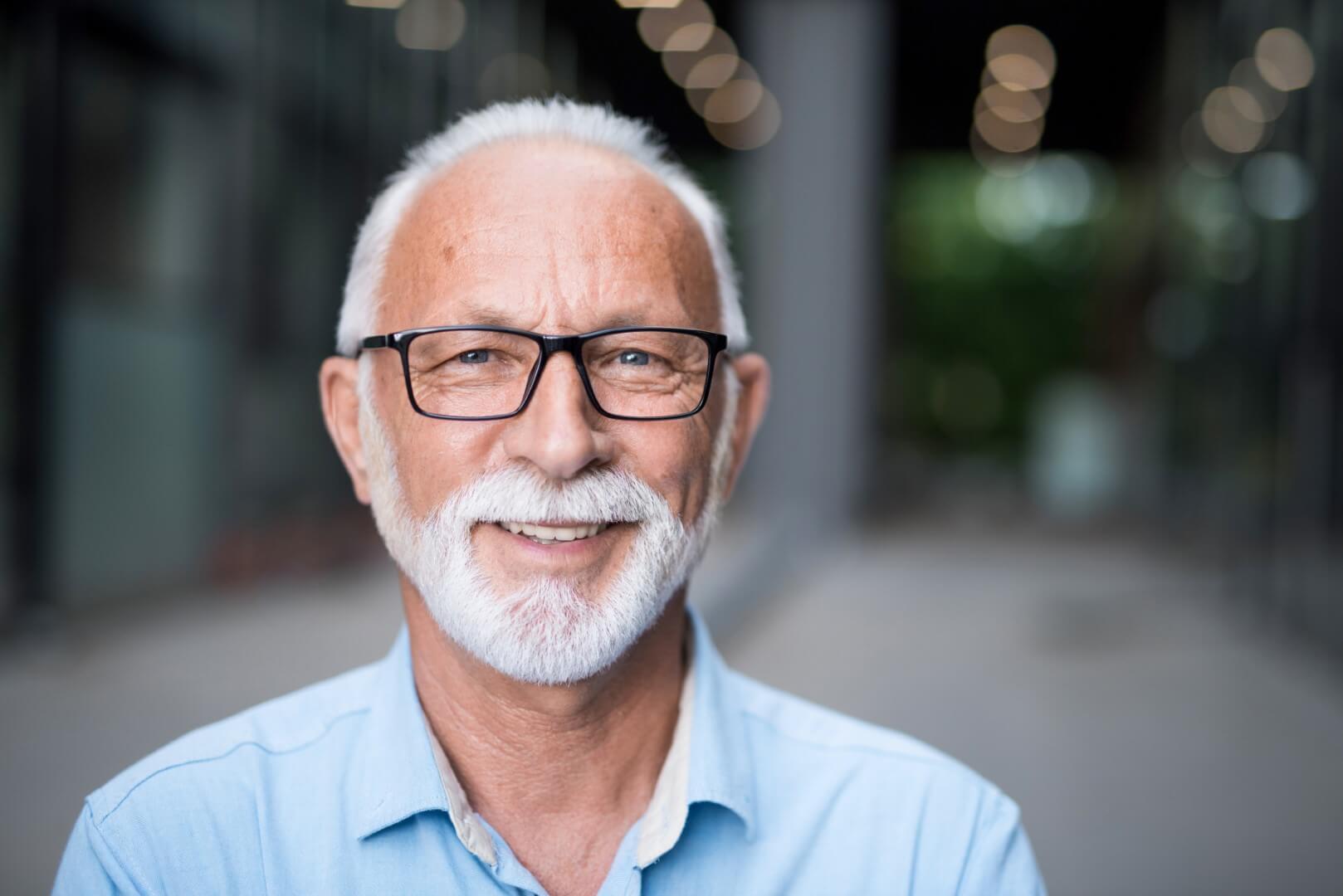
Wer sind die Babyboomer?
Als «Babyboomer» werden die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsjahre bezeichnet. Ausgelöst wurde der Baby-Boom nicht durch mehr kinderreiche Familien, sondern hauptsächlich durch die Tatsache, dass mehr Frauen Kinder zur Welt brachten als früher. Wie jede andere Generation verwarfen die Babyboomer in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenalter oft die bürgerlichen Lebens- und Familienideale ihrer Eltern. Sie experimentierten mit neuen Lebensformen, wie Singlesein, nichtehelichem Zusammenleben, Wohngemeinschaften; alles Lebensformen, die auch heute noch die nachberufliche Lebensphase prägen und zum Beispiel zu Altershausgemeinschaften führen.
Die demographische Auswirkung der Babyboomer-Generation
Die Tatsache, dass die geburtenstarke Babyboom-Generation selbst weniger Kinder zur Welt brachte, ist ein wichtiger Auslöser für eine verstärkte demographische Alterung – wobei das allmähliche Altern der Babyboom-Generation zu drei Phasen beschleunigter demographischer Alterung führt.
Phase 1: Rasche demographische Alterung der Erwerbsbevölkerung.
Die Pensionierungswellen geburtenstarker Jahrgänge tragen in gewissen Branchen zu einem Fachkräftemangel bei, beispielsweise im Pflegebereich: Bis 2030 werden gut zwei Drittel des neu zu rekrutierenden Pflegepersonals allein dazu benötigt, pensionierte Personen zu ersetzen.
Phase 2: Rasches Wachstum der Rentnerbevölkerung.
Dies erfordert Anpassungen der Rentensysteme – etwa eine Erhöhung des Rentenalters oder eine Stärkung der Freiwilligenarbeit seitens pensionierter Frauen und Männer.
Phase 3: Beschleunigte, gesundheitspolitisch bedeutsame Zunahme an pflegebedürftigen alten Menschen.
Studien zeigen, dass die Nachkriegsjahrgänge länger behinderungsfrei bleiben werden als frühere Geburtsjahrgänge. Dies kann die Zunahme an pflegebedürftigen alten Menschen zwar bremsen, aber kaum vollständig aufhalten. Gesellschaftspolitisch interessant wird auch die Frage sein, wie beziehungsweise ob die Nachkriegsjahrgänge – die verinnerlicht haben, lebenslang aktiv und jugendlich zu sein – schlussendlich das höhere Alter akzeptieren.
Die Pensionierung als Chance
Die Pensionierung bedeutet heutzutage für viele nicht mehr nur Ruhestand, Rückzug, Defizite und Verluste, sondern sie ist eine Lebensphase mit vielfältigen und bunten Gestaltungsmöglichkeiten und neuen Chancen. Bisher vernachlässigte Kompetenzen – bezüglich sozialer Kontakte, Gartenarbeiten, Bildung und so weiter – können ausgelebt werden. Dabei ist auch die Wohnform entscheidend.
Interessiert Sie das Thema «Wohnformen im Alter»? Dann lesen Sie den Blogbeitrag zum Thema Seniorenwohngemeinschaften.
Machen Sie sich Gedanken über Ihre Wohnsituation im Alter? Kontaktieren Sie mich.
Weitere AphorismenNicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.
Christian Morgenstern

